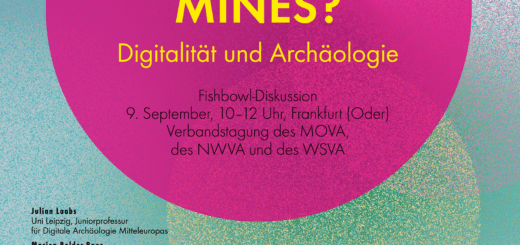CfP „Disiecta membra: Geisteswissenschaftliche Zugänge zu Teil und Ganzem“
Interdisziplinäre Tagung des Akademie-Projektes „Disiecta Membra: Steinarchitektur und Städtewesen im römischen Deutschland“ vom 27.–29.11.2025 an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
In der Literatur- und der Musikwissenschaft, der Kunstgeschichte, der Geschichtswissenschaften, der Philosophie und in den Archäologien wird der Ausdruck ‚disiecta membra‘ im Zusammenhang mit Studien zu Fragmenten oder Teilen eines Ganzen genutzt: Fragmente eines literarischen oder musikalischen Werks, Fragmente von Skulpturen, Gemälden oder anderen Kunstwerken, Ruinen, isoliert betrachtete Teile eines Konzepts, einer Theorie oder eines Werks, und im Kontext von Praktiken am menschlichen Körper. Auch retrospektive Werkschauen charakterisieren mit dem Begriff die Breite eines philosophischen oder künsterlischen Œuvres.1
Das 2023 begonnene Langzeitvorhaben „Disiecta Membra. Steinarchitektur und Städtewesen im römischen Deutschland“, das von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz gefördert wird, nutzt diesen Ausdruck für Bauglieder, die sich heute nicht in ihrem ursprünglichen Kontext befinden. Sie gehörten einst zu römischen Architekturen, wurden dann aber erneut verbaut, sind Teile von Lapidarien oder gingen verloren, so dass einige nur noch als Inventarnummer existieren. Durch ihr Zusammentragen wollen wir Gesamtheiten von Bauwerken erschließen und damit die Kenntnisse über dieses kulturelle Erbe vertiefen sowie Forschungen zur frühen Urbanität
ermöglichen

Zur Junktur ‚disiecta membra‘
Die Junktur ‚disiecta membra‘ ist aus der antiken Literatur überliefert. Hier kommt sie einmal als Zustandsbeschreibung des Körpers des getöteten Hippolytus im letzten Akt der Tragödie Phaedra des Seneca vor: Disiecta genitor membra laceri corporis / in ordinem dispone et errantes loco / restitue partes (LLA 335.TR, Vers 1256, S. 199); Theseus lässt die Gebeine des Hippolytus zusammensuchen und zur Bestattung geordnet an einem Ort ablegen. In den Satiren des Horaz (I, 4) erscheint sie in den Erörterungen, was Dichtung sei, als metaphorischer Ausdruck. Löse man einen Vers in seine Worte auf (55. Quem si dissolvas, quivis stomachetur eodem; Dass, wenn er aufgelöst, leicht würd‘ sich ein jeglicher ärgern), nehme ihm den Rhythmus und den Takt (57. Olim quae scripsit Lucilius, eripias si / 58. Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est; welches vordem aufschrieb Lucilius, wenn du ihm abziehst / Sicheren Rhythmus und Takt, und was in der Ordnung vorangeht), so könne man doch stets des Dichters zerstreute Glieder/Worte finden (62. Invenias etiam disiecti membra poetae; Findest du leicht noch heraus die zerstückelten Glieder des Dichters). (https://www.projekt-gutenberg.org)
Ist ‚disiecta membra‘ in der antiken Literatur ein Ausdruck für zerteilte und verteilte Glieder menschlicher Körper, wird in den Geisteswissenschaften der Körper als Konkretum, aber insbesondere als Metapher, und dann meist als ‚Korpus‘, begriffen, der Zerstreutes vereint. Wie aber wird der Körper/Korpus in diesen Wissenschaften gedacht? Ist er das Ideal eines Ganzen, bei dem bekannt ist, was zu ihm gehört und aus welchen Teilen er besteht? Vielleicht so, wie er in Johann Amos Comenius’ lange sehr einflussreichem Schulbuch Die sichtbare Welt (ab 1653 in mehreren erweiterten Auflagen) aufgelistet und dargestellt wurde? Auf welche nicht-lebenden Gesamtheiten ist die Metapher anwendbar? Welche Eigenschaften muss eine Gesamtheit haben, um als Körper/Korpus verstanden zu werden? Wie relevant ist Abgrenzung und Teilbarkeit?
Dem schließen sich Fragen nach dem wissenschaftlichen Umgang mit dem Zerstreutsein von Teilen an. Sind Akte und Praktiken der Zerteilung und Zerstreuung Gegenstand der Forschung? Welche Möglichkeiten der Erforschung und Vermittlung von trennenden Akten gibt es? Oder ist Zerstreutsein immer schon eine Aufforderung nach der Sammlung dieser Teile und ihrer (Wieder-)Zusammenfügung? Welchen Kriterien und Prämissen folgen zusammenführende Forschungen? Sind Originalzustand und Vollkommenheit das Forschungsziel, und warum?
Diese und weitere Themen möchten wir anhand von Fallbeispielen aus der gesamten Breite der Geisteswissenschaften sowie den Digital Humanities diskutieren. Willkommen sind sowohl konzeptionelle, theoretische und philosophische Beiträge als auch Studien zu historischen und aktuellen Beispielen von Akten des Zerteilens, Zerstreuens oder Zusammentragens. Die Tagung möchte den interdisziplinären Austausch zu Begriffen, Metaphern, Modellen, Theorien, Methodiken und Praktiken zu Teil und Ganzem anregen und neue Perspektiven, die sich auch durch die digitale Transformation eröffnen, diskutieren.
Bei Interesse bitten wir um die Einsendung eines Abstracts (max. 400 Wörter) und einer Kurzbiographie bis zum 31.07.2025 an disiecta-membra@adwmainz.de
Tagungsort: Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz
Tagungssprache: Deutsch und Englisch
Vortragslänge: 25–30 Minuten
Übernachtungs- und in Einzelfällen Reisekosten können übernommen werden.
Eine Publikation der Tagungsbeiträge wird angestrebt
Konzeption und Organisation der Tagung: Dr. Katja Rösler
- z.B. G. Varelli (Hrsg.), Disiecta Membra Musicae. Studies in Musical Fragmentology (Leiden, 2020); M. Dall’Asta, Disiecta membra. Briefe als Quelle der Kulturgeschichte, in: Ders. (Hrsg.), Philipp Melanchthon in der Briefkultur des 16. Jahrhunderts (Heidelberg 2015), 13–34; S. Mergenthal, Disiecta membra poetarum. Über das Sammeln von Dichterreliquien, in: A. Assmann (Hrsg.), Sammler – Bibliophile – Exzentriker (Tübingen 1998), 87–98; A. und J. Assmann, Membra disiecta. Einbalsamierung und Anatomie in Ägypten und Europa, in: G. Brandstetter u.a. (Hrsg.), ReMembering the body: Körper-Bilder in Bewegung [anläßlich der Ausstellung STRESS im MAK, Wien] (Wien 2000); O. Marquard et al. (Hrsg.), Disiecta Membra Studien. Karlfried Gründer zum Geburtstag (Basel 1989). W. Ette, Aggregat Lebe : Ovid und Alexander Kluge, in: Komparatistik, Band 2008/2009 (2010) 155: „Kluges Werk entwirft die „disiecta membra“ eines Ganzen…“. ↩︎